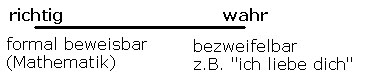
Mitschrift zur Vorlesung "Wissenschaftstheorie der Physik"
von Prof. Herbert Pietschmann, Sommersemester 2004.
Bei Fehlern, Kritik oder Fragen -> jelena.horky@aon.at
Übersicht:
Einleitung
Geschichte
Das Experiment
Finden von Theorien
Elimination des Widerspruchs
Naturgesetze
Realitšt und Wirklichkeit
Reduktionismus
Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Frage, warum Wissenschaft funktioniert. Denn während die Mathematik etwas vom Menschen geschaffenes beschreibt, befasst sich die Physik mit der Welt, in die wir gesetzt wurden. Mathematische Beweise ("aus gewissen Voraussetzungen folgt") sind nicht anzweifelbar, aber erfüllt die Natur diese Voraussetzungen?
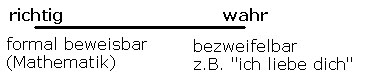
Etwas wird dadurch "wahr", dass es nicht bezweifelt wird (z.B. bei einer Religion), es ist aber grundsätzlich bezweifelbar. Wahrheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit! Für die Naturgesetzte ist jedoch eine dritte Kategorie notwendig.
Zwischenmenschliche Kommunikation passiert auf vier Ebenen: Inhalte, Selbstdarstellung, Beziehung und Apell. Die "Wahrheit" kann sich nicht bloß auf die Inhalte beziehen.
Wie ist es möglich, zu absoluten Aussagen zu kommen, die nicht beweisbar sind? -> Wissenschaftstheorie.
Logik: Denkgesetze, die ca. 2500 Jahre alt sind, entstanden in der sogenannten "Achsenzeit". Vor ihr, im Zeitalter des Mythos, gab es keine Fragen der Naturerkenntnis, sondern der Mensch wurde mit der Natur als Einheit gesehen.
Heraklit: "alles fließt", Entstehung
durch den Kampf der Gegensätze; "Werden"
Parmenides: "das Sein ist", "das
Nichtsein ist nicht", es gibt keine vernünftige Beschreibung der Natur;
"Sein"
Das was sich ändert, muss zugleich gleich bleiben, sonst ist es etwas anderes.
Platon: die Welt hat zwei sich widersprechende Seiten, Sein & Werden
Sein |
Werden |
| Vernunft, Verstand; intelligible Welt; Welt der Ideen (ewig und unveränderlich) |
mit den Sinnen erfahrene Erscheinungen; ändert sich ständig |
-> die Philosophie (Sein) kann sich nicht mit der Natur (Werden) befassen -> es kann keine Naturphilosopie existieren.
Er war ein Schüler von Platon, und sagte, da wir die Natur verstehen wollen, können wir keinen Widerspruch in unser Denken aufnehmen. Wir müssen Sätze finden, die kein vernünftiger Mensch bezweifeln kann, zum Beispiel "das Sein ist".
Darauf begründete er seine Logik:
1) Satz der Identität: A = A ungleich ¬A
(nicht A); alles ist mit sich selbst ident und mit allem anderen verschieden.
2) Satz vom Widerspruch: von zwei einander widersprechenden
Aussagen ist mindestens eine falsch.
3) Satz vom ausgeschlossenen Dritten: ist bei zwei
sich widersprechenden Aussagen der Widerspruch vollständig, so ist eine
Aussage richtig und eine falsch.
Mathematischer Beweis = die Aussage verträgt
sich mit den drei Axiomen der aristotelischen Logik.
Beispiel: Behauptung, dass es unendlich viel Primzahlen gibt. Nach dem 1. Axiom
müssen alle Begriffe genau definiert sein -> "Primzahl ist eine
Zahl, die genau zwei Teiler hat" (1 und sich selbst). Nun führt man
durch einen indirekten Beweis die Annahme "es gibt endlich viel Primzahlen"
auf einen Widerspruch (3. Axiom): sind P1, P2, ..., Pn Primzahlen, so ist P1*P2*...*Pn
+ 1 = P(n+1) wieder eine Primzahl.
Die Mathematik ist jedoch keine
Naturwissenschaft! So ist zum Beispiel ein Beweis durch vollständige
Induktion in der Mathematik möglich, nicht aber in der Naturwissenschaft.
Ein physikalisches Axiomesystem muss im Gegensatz zum mathematischen nicht nur
richtig, sondern auch wahr sein.
Aristoteles sagte nun: wir müssen ein System von unmittelbar
einsichtigen Prinzipen finden und aus denen schließen:
*) Induktion: Schluss von n auf n+1, nicht aussagekräftig
*) Analogie: wenn etwas ähnlich ist, wird es ähnliche Konsequenzen
haben, hat eine Bedeutung beim Auffinden von Gesetzmäßigkeiten, nicht
aber beim Überprüfen
*) Deduktion: Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere, A=B, B=E ->
A=E
Die allgemeinen Prinzipien können aber nicht bewiesen werden, sondern müssen
als wahr genommen werden. Aus einem genügen großen Satz von Prinzipien
kann nun eine Naturbeschreibung folgen.
Aristotles führte auch den Begriff der Kausalität
ein: das was bei einer Veränderung herauskommt, ist in der Veränderung
schon angelegt.
1) causa finalis: Zielursache (Entschluss)
2) causa formalis: Formursache (Plan)
3) causa materialis: Materialursache
4) causa efficiens: Wirkursache -> heutige Definition von Kausalität,
Ursache-Wirkung
Die Mathematik is zur Naturbeschreibung ungeeignet, weil sie nur die causa formalis berücksichtigt.
Aristotelische Physik: Eine Kraft
ist (bei irdischen Bewegungen) proportional zur Geschwindigkeit; die Physik
wird in einen Teil ober- und einen Teil unterhalb der Späre des Mondes
aufgeteilt.
Es gibt 4 Elemente: Feuer, Wasser, Erde, Luft; je
mehr vom Element Erde ein Körper besitzt, desto schwerer ist er und desto
schneller fällt er (Erde will zu Erde), feuerförmige Elemente steigen
auf. Das ganze ist eine Erfahrungswissenschaft, im Gegensatz zu unserer heutigen
experimentellen Wissenschaft.
Oberhalb der Späre des Mondes gibt es ein 5. Element, die Quintessenz,
dort ist alles edel und vollkommen, es gibt nur Kreisbewegungen. Darauf beruht
auch das Ptolemäische Weltbild mit seinen Epizyklen und Exzentern.
Bei allen Kulturen außer dem Islam und unserer ist die Religion in der
Achsenzeit entstanden, sie ist also gleichzeitig mit der Philosophie und der
Logik entstanden.
Die Tatsache, dass dies in unserer Kultur nicht so war, brachte Widersprüche
in sie, sie hat zwei Wurzeln, Athen und Jerusalem.
Konstantinische Wende (ca. 300 n.Chr.): das Christentum
wird zur Staatsreligion, eine Religionsphilosophie, die Theologie, wird geschaffen.
Augustinus vereinigte die griechische Philosophie mit dem Christentum, nicht
aber die aristotelische Philosopie. Der zentrale Glaubenssatz des Christentums,
die Dreifaltigkeit, steht im Widerspruch zu den aristotelischen Axiomen der
Logik, nicht aber zu Platon -> Aristoteles wurde vergessen, es kam zum Neuplatonismus.
Islam: Der Beginn der islamischen
Zeitrechnung (in Mondjahren) ist die Flucht von Mohammed von Mekka nach Medina
622. Er vereinigte die Araber: Muslime dürfen einander nicht bekämpfen,
Mädchen dürfen nicht getötet werden und ein Mann darf nicht mehr
als 4 Frauen haben.
Dadurch stiegen die Araber innerhalb von nur zwei Jahrhunderten zur Weltmacht
auf. Sie entdeckten die Philosophie des Aristoteles, die zum Koran keinen Widerspruch
darstellt, da dieser sich nur mit Glaubensfragen und Fragen des praktischen
Lebens beschäftigt.
Von den Arabern haben wir unter anderem die Mathematik (vor allem die Zahlen;
Einführung der Null, die ja ein Widerspruch in sich ist, da sich das Nichts
nicht denken lässt; Aristoteles: die Natur kennt kein Vakuum), die Algebra,
den Algorithmus,... Als die Araber im 12. Jahrhundert nach Europa kamen, kam
es hier zu einer Blüte der Mathematik (z.B. Adam Riese).
In Europa kam es zu einer Krise in der Philosophie,
weil Aristoteles nicht negiert werden konnte, die Frage, was Wahrheit ist, stand
im Mittelpunkt. Man versuchte ein Weltbild mit zwei Wahrheiten zu konstruieren
(Glaube und Aristoteles).
Thomas von Aquin konnte sie vereinigen. Diese Eine
Wahrheit, die Welt und Glauben beschreibt, musste gegen Ungläubige
verteidigt werden, denn wenn sie öffentlich bezweifelt wird, ist sie in
Gefahr. Die Kritiker wurden ausgestoßen, als vogelfrei erklärt oder
gegen Ende des Mittelalters sogar öffentlich verbrannt.
Als 1492 die Entdeckung Amerikas den Beginn der Neuzeit markiert, war dies ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Columbus glaubte, die Welt ist eine Kugel, er erbrachte den Beweis jedoch nicht durch Denken, sondern durch Handeln. In der Naturwissenschaft rückte das Experiment in den Vordergrund.
Tycho de (von) Brahe brachte das aristotelische Weltbild ins Wanken, indem er zum Beispiel bewies, dass Kometen weiter entfernt sind als der Mond und indem er eine Supernova beobachtete. Somit gab es auch oberhalb der Späre des Mondes Veränderung.
Kalender: von Caesar bis ins 16. Jahrhundert
galt der Julianische Kalender, der zwar die Schaltjahre berücksichtigte,
nicht aber dass nicht immer alle vier Jahre ein Schaltjahr sein muss. Somit
war er bis ins 16. Jahrhundert um 10 Jahre falsch.
Der Kalender war die Klammer zwischen Natur und Glaube, er verband Ernte/Aussaat
und die beweglichen Feste wie Ostern und Pfingsten. Nur der Papst durfte etwas
am Kalender verändern.
1582 - Einführung des Gregorianischen Kalenders.
Kopernikus (Domherr von Frauenberg) veröffentlichte
1542, dass die Sonne im Zentrum der Welt steht und sich die Planeten um sie
bewegen, so auch die Erde. Er berechnete auch den Kalender neu.
Die Jesuiten lehrten zu dieser Zeit in Rom schon seine Lehre.
Die Kirche unterschied in dieser Zeit zwischen Wahrheit, die sich immer auf das Ganze beziehen muss, und Hypothesen für irdische Probleme. Diese Hypothesen sind ihrer Natur nach falsch, da sie sich nicht auf das Ganze beziehen, sie erheben also keinen Anspruch auf Wahrheit. Sie sind aber auch nicht beliebig und stehen somit neben der Wahrheit.
Er war der Begründer der Naturwissenschaft (Nuova Scenca, Neue Wissenschaft). Ein wichtiger Punkt in seinem Leben war der Streit um den Nachweis der Bewegung der Erde.
Giordano Bruno: Mönch in Neapel, Flucht aus dem Kloster -> wurde exkommuniziert, wurde Calvinist -> wieder exkommuniziert, wurde Lutheraner -> wieder exkommuniziert. Er befand sich in Venedig, von wo aus eigentlich niemand an die Inquisition ausgeliefert wurde, jedoch wurde bei ihm eine Ausnahme gemacht und er am Scheiterhaufen verbrannt.
Die folgenden Beweise, dass die Erde ruht, mussten entkräftet werden: Speerargument, Turmargument. Die Widerlegung war die Galilei-Transformation, nach der alle Bewegungen relativ zu einem Bezugssystem zu sehen sind.
Galilei beobachtete den Mond, die Sonne, ... (er erfand das Fernrohr) und entdeckte
die Jupitermonde, die Sonnenflecken, die Mondkrater und die Venusphasen. Aristoteliker
sagten zum Fernrohr: entweder es bestätigt Aristoteles oder es verändert
die Realität.
Man berechnete die Venusphasen nach Ptolemäus und nach Kopernikus, kam
aber zu anderen Ergebnissen; die Beobachtungen gaben Kopernikus recht, Ptolemäus
war somit experimentell widerlegt.
1616 wurde Galilei in Rom von der Inquisition (unter
Bellamin) angeklagt, jedoch wurde er freigesprochen, wenn er nur von Hypothesen
spricht.
1624 wurde Maffio Barbarini, ein Landsmann Galileis, Papst -> Urban VIII
1630 reichte Galilei seine Schrift "Dialog über die beiden hauptsächlichen
Weltsysteme", in der es um den Beweis für die Bewegung der Erde ging,
bei der Inquisition ein.
1630-32 - Prüfung der Inquisition, sie verlangte einige Änderungen.
1632 - Veröffentlichung mit Genemigung der Kirche
1633 - Urban VIII verlangte den Prozess (dies war mitten im 30jährigen
Krieg, einem Glaubenskrieg in dem der Papst oberster Kriegsherr war)
Es gibt 3 Hypothesen, warum es schließlich doch zu einer Anklage kam:
1) Tauben + Falken - Falken verlangten härteres Durchgreifen, der Papst
wollte den Prozess als Ablenkungsmanöver benutzen
2) Feinde Galileis wiesen auf das Symbol der abtrünnigen Rosenkreuzer hin
3) das Buch ist als ein Dialog dreier geschrieben, einer davon ist er einfältige
Simplizio, der am Ende einen Ausspruch Urbans benutzte
Die Anklage wurde wegen Ungehorsams erhoben, die Verurteilung war einstimmig (die Akten sind nach dem Prozess verschwunden), Galilei musste abschwören und wurde unter Hausarrest gestellt.
Sein zweites Werk, die Grundlagen der Mechanik, veröffentlichte er in
Holland, Gott kam darin nicht mehr vor.
Unter anderem untersuchte er in einer Kirche (in Pisa) Lusterschwingungen und
stellte fest, dass die Schwingungsdauer unabhängig von der Amplitude ist.
Er wurde nach seinem Tod in einer Kirche in Florenz begraben.
Seine Mutter hatte einen Hexenprozess, er wollte durch seine Forschung den Glauben stärken und am Himmel perfekte Kreise entdecken. Jedoch entdeckte er, dass die Planetenbahnen "unvollkommene" Ellipsen waren (das kam laut der christlichen Ideologie von der Erbsünde).
Dass das Verhältnis des Aphels bzw. Perihels zur Winkelgeschwindigkeit bei verschiedenen Planeten konstant ist, wurde als Wille Gottes gesehen.
Er veröffentlichte 1687 ein erstes geschlossenes Werk der Physik, sein
Gravitationsgesetz führte die Gesetze ober- und unterhalb des Mondes zusammen.
Er hatte schon als Knabe über das Gravitationsgesetz nachgedacht um Streitigkeiten
mit seinem Rivalen Hook zu gewinnen.
Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung sprach man nicht mehr nur von Hypothesen, sondern wieder von der Wahrheit.
Kirche und Wissenschaft trennten sich, die Wissenschaft wurde frei.
Immanuel Kant (1724 - 1804) stellte zum Beispiel die Frage (in "Kritik der reinen Vernunft"): Wie ist Wissenschaft möglich?
Naturgesetze sind nicht beweisbar, sondern nur falsifizierbar.
Eigenschaften:
1) reproduzierbar
2) quantitativ
3) Analyse
Der Sinn des Experiments ist, zwischen verschiedenen Hypothesen zu unterscheiden und falsche Theorien auszuschließen (zu falsifizieren).
Die Erfahrung wird durch das Experiment ersetzt, die Theorien beziehen sich allerdings nie auf das Ganze, da wir seit Galilei die Einsicht haben, dass die Natur zu kompliziert ist, um sie systematisch zu beschreiben. Die Welt wird also gedanklich in einfache Teile zerlegt. Wir beschreiben dadurch nicht die "Welt, in der wir leben" aber wir können Gesetze finden, die diese beschreiben.
Aporie: ein Widerspruch, der nicht eliminiert werden kann (wie das Problem von Henne und Ei), steht im Gegensatz zur Logik (in der Logik lässt sich auf Grund von Widersprüchen alles beweisen).
Das Experiment muss nicht nur selbst wiederholbar sein, auch ein aus dem Phänomen
abgeleitetes Phänomen muss reproduzierbar sein. Allerdings gibt es dabei
eine Aporie: kein Ereignis ist exakt wiederholbar!
Der Ausweg ist eine operationale Bewältigung,
das Erfinden eines Mechanismus' bei dessen Anwendung sich der Widerspruch nicht
mehr auswirkt: die Angabe des Messfehlers,
also eines Bereiches in dem das Experiment als reproduziert gilt. Als Folge
der Aporie gibt es auch kein Experiment ohne Messfehler.
Es ist auch ein Konsens unter den Fachleuten notwendig, um zu entscheiden, ob
ein Experiment als reproduziert gilt.
Aus den gewonnenen Daten erfolgt eine Extrapolation, in die weitere Annahmen eingehen. Es ist aber grundsätzlich unmöglich, alle Effekte zu berücksichtigen. Also sind die Ergebnisse grundsätzlich falsch (Aporie!). Als Lösung gibt man einen systematischen Fehler an, dieser kann aber in der Theorie nicht angegeben werden, man kann ihn lediglich abschätzen, denn würde man ihn kennen, so müsste man ihn korrigieren.
Descartes: Zweifel als Mittel,
man kann nicht daran zweifeln, zu zweifeln -> zweifelnd bin ich -> denkend
bin ich ("Ich denke also bin ich"). Die einzige Wahrheit ist die Existenz
des Denkens (res cogitans) - Geist, aber auch die des ausgedehnten Denkens (res
extensa) - Materie.
Seine Forderung an die Anaylse: sie solle sich nur auf res extensa, die Materie,
beziehen, nicht aber auf den Geist.
[Solepsismus: nur ich existiere, alles andere ist quasi Halluzination.]
Es gibt hierbei grundsätzlich eine Aporie, denn das Experiment ist eine Grundlage für die Theorie, die Theorie aber Voraussetzung für ein Experiment.
Induktion ist nicht sinnvoll um auf eine Theorie zu schließen, sie würde zu falschen Ergebnissen führen, denn wenn es ohne eine Theorie dahinter viele Experimente gibt, sind mindestens einige davon falsch. Will man nun nur durch Induktion auf eine Theorie schließen, so werden diese falschen Experimente durch sie ebenfalls beschrieben.
Beispiele:
*) 1962 Gell-Mann: Schema für Elementarteilchen sagte
ein Ω--Teilchen voraus, dieses wurde 1964 entdeckt, später
erst erkannte man, dass dieses Teilchen schon 1954/55 drei Mal gesichtet wurde.
[ähnlich wie Phänomen der selektiven Wahrnehmung]
*) 1968 wurde von Salam-Weinberg die Theorie der neutralen
schwachen Ströme aufgestellt. Diese wurden 1974 entdeckt. Allerdings wurden
sie schon 1967 entdeckt, jedoch galt damals die Theorie, dass diese Ströme
gar nicht existieren.
*) "Charmed" particles: diese wurden 1970 vorausgesagt
und 1976 entdeckt. Eigentlich wurden sie aber schon 1963 gesichtet, damals aber
als ein Hinweis auf ein anderes Teilchen interpretiert.
Für alle drei Theorien wurde übrigens der Nobelpreis verliehen.
In den 50er Jahren, als man nach einer Erklärung für die schwache Wechselwirkung suchte, wurden dazu viele Experimente gemacht. Man nahm den allgemeinsten Ansatz an und entwickelte daraus eine Theorie. Diese beschrieb zwar alle Experimente, war aber falsch!
Es ist also wichtig, sich zuvor eine Meinung zu bilden, welchen Experimenten man glauben will. Dazu dienen auch die großen Weltkonferenzen, bei denen ein Konsens unter den Fachwissenschaftlern entsteht. Zwischen den Wissenschaftlern gibt es dabei immer Konkurrenz, einer versucht etwas zu entdecken, der andere versucht es zu widerlegen.
Alles, was von einem genügend bedeutenden Theoretiker vorhergesagt wird, wird auch entdeckt, unabhängig davon, ob es existiert oder nicht. Kriterium für die Existenz eines Effektes ist daher nicht seine Entdeckung sondern die Reproduzierbarkeit.
Wenn alle Skeptiker überzeugt sind, nimmt man an, der Effekt existiert, und zwar schon immer. Es gilt aber auch umgekehrt:
Alles, was von einem genügend bedeutenden Experimentalphysiker entdeckt wird, wird auch erklärt, egal ob es existiert oder nicht. Kriterium ist daher erst der Konsens.
Die Theorien existieren oft schon, bevor das Experiment reproduziert wurde. "Verstanden" heißt also nicht, dass eine Erklärung existiert, sondern erst wenn ein Konsens besteht, dass diese Erklärung die einzig richtige ist.
Einstein: Die Erlebnisse (bzw. Experimente)
sind uns gegeben; aus den Axiomen (oder Prinzipen)
folgern wird. Psychologisch basieren die Axiome auf den Experimenten, es gibt
aber keinen logischen Weg um sie zu finden. Aus den Axiomen werden einzelne
Ableitungen (durch Deduktion) gemacht, die Anspruch auf Richtigkeit haben, sie
werden an den Experimenten geprüft.
Die Prinzipe werden erfunden, sodass die Folgerungen mit den
Experimenten übereinstimmen!
Eine Theorie kann Experimente als falsch erklären. Nun gibt es folgende
empirische Feststellung: erklärt eine Theorie ein Experiment, das alle
für richtig halten, für falsch, und wird dies bestätigt, die
gewinnt die Theorie an Sicherheit.
Je absurder die Voraussagen einer Theorie sind, wenn sie bestätigt werden,
ist die Theorie damit umso sicherer.
Dirac: seine Theorie sagte Antiteilchen voraus, positive Elektronen (Positronen) zum Beispiel. Diese wurden schon früher in der kosmischen Strahlung entdeckt, jedoch hielt man sie für Elektronen die von der falschen Seite in den Detektor (Nebelkammer) gelangt sind. Erst von Anderson wurden die Positronen als solche erkannt.
Die Aufgabe eines Theoretikers besteht aus zwei Teilen: Aufstellen der Prinzipe und Deduktion (Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere). Der erste Teil geschieht nicht durch Induktion sondern durch Intuition, der zweite Teil aber kann erlernt werden.
Es kann aber mit unterschiedlichen Prinzipen die selbe Theorie gefunden werden! die Prinzipe sind keine tieferen Einsichten sondern sind in einem gewissen Rahmen frei erfunden.
Die Naturwissenschaft ist auch nicht grundsätzlich objektiv, die Erwartungen der Wissenschaftler erfüllen sich oft zu unrecht. Deshalb verwendet die Naturwissenschaft die Methode der doppelten Negation (jemand will etwas widerlegen, reproduziert es aber statt dessen), eine dialektische Disziplin.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Theorien: prädiktive und konsistente. Prädiktive Theorien machen Vorhersagen, die am Experiment überprüft werden können, konsistente Theorien erklären bloß etwas Vorhandenes ohne in Widerspruch mit anderen Theorien zu kommen (z.B. Urknall-Theorie). Die vorherigen Aussagen beziehen sich auf die erste Art von Theorien.
Beim Umgang mit Menschen ist es oft wichtig, eine doppelte Negation zu verwenden (zum Beispiel beim Unterrichten: "nicht wieder vergessen").
Die Einstellung des Naturwissenschaftlers sollte zugleich offen und kritisch sein -> Aporie -> keine logische (statische) Lösung. Die Begriffe "offen" und "kritisch" sind nicht eindeutig definiert, sie haben wie C.G. Jung es ausdrückte, einen Schatten:
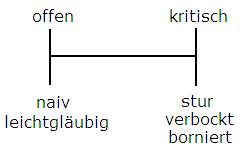
Wer zu offen ist, wird naiv und leichtgläubig, wer zu kritisch ist wird stur, verbockt und borniert.
H-X-Verwirrung:
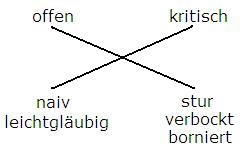
Die Kritischen kämpfen gegen die Naivität und werden dadurch stur während die Offenen gegen die Sturheit kämpfen und dadurch naiv werden.
Lösung: die Kritischen müssten eigentlich gegen die Sturheit ankämpfen und die Offenen gegen die Naivität, jedoch müssen beide Seiten das gleichzeitig einsehen, damit nicht eine zum Sieger über die andere wird.
Die Unterscheidung "offen" und "kritisch" bezieht sich auch auf den Zeitgeist der Wissenschaft (manchmal zu offen, manchmal zu kritisch).
Beispiel für zu kritisch:
Meteoriten
Diese passten zur Zeit der Aufklärung nicht in die "Himmelsordnung",
jedoch gab es immer wieder Zeugen und Funde. Der Physiker und Strafverteidiger
Chladni befragte die Zeugen und befand sie als glaubwürdig (als Strafverteidiger
konnte er soetwas mit großer Sicherheit erkennen).
Die französische Akademie der Wissenschaften erklärte 1772 jedoch:
"es ist unmöglich, dass Steine vom Himmel fallen, die Zeugen sind
entweder Lügner oder Irre und die gefundenen Meteoriten sind Steine, in
die der Blitz eingeschlagen hat". Chladni wurde als "unmoralisch"
verteufelt und viele Museen warfen ihre Meteoriten-Sammlungen weg (nicht aber
in Wien).
Am 26. 4. 1803, als der Streit gerade im Gange war, ging über l'Aigle einem
Vorort von Paris der größte Meteoritenschauer aller Zeiten nieder
(3000 Steine, bis zu 9 kg schwer). Die erste Reaktion der Zeitungen auf dieses
Ereignis war jedoch: "Bürgermeister von l'Aigle irre", nach genauerer
Betrachtung konnte jedoch niemand mehr die Existenz von Meteoriten leugnen.
Beispiel für zu stur: N-Strahlen
Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele neue Strahlen gefunden wurden (Röntgenstrahlen,
Radioaktivität...) entdeckte René Blondlot (Nancy) die N-Strahlen,
die unter anderem vom Blutkreislauf ausgestrahlt wurden.
In der ersten Hälfte des Jahres 1904 wurden in Frankreich 54 Arbeiten zu
diesem Thema veröffentlicht, aber nur 3 über X-Strahlen.
Professor Wood aus den USA gelang es aber nicht, die N-Strahlen bei gleichem
Versuchsaufbau zu sehen und er reiste extra nach Frankreich um sie sich von
den dortigen Kollegen zeigen zu lassen. Jedoch konnte er auch da keine N-Strahlen
entdecken, es gibt sie einfach nicht!
Fotografien von ihnen werden im nachhinein auf unbewusst verschieden lange Belichtungszeiten
zurückgeführt.
Tritt zwischen Experiment und Theorie ein Widersruch auf, so gibt es verschiedene Stufen, auf denen dieser beseitigt werden kann:
1. Phase: Kritik (am Experiment)
2. Phase: Phänomenologische Analyse
3. Phase: Einschränkung des Gültigkeitsbereichs / Zusatzhypothese
4. Phase: Modifikation der Theorie
2. Phase, Phänomenologische Analyse: der Widerspruch wird vorerst vergessen und das Phänomen genau untersucht. Am Beispiel der Meteoriten: sind entweder Zusammenklumpung in der Atmosphäre, vom Mond kommend, von der Erde kommend (Vulkane) oder aus dem Weltall kommend (letztere Idee stammt von Chladni, er setzte sich schließlich auch durch).
Technische Sicherheit: da es in der Wissenschaft immer systematische Fehler gibt, muss es einen gewissen Sicherheitsfaktor geben, über dessen Größe es einen Konsens der Gesellschaft geben muss. Zum Beispiel wird eine Brücke, die 3 Tonnen Last tragen muss, für 30 Tonnen berechnet (Faktor 10). Im Flugverkehr wird nur ein Faktor 1,5 verwendet, da sonst die Kosten zu groß wären.
Karl Popper beschrieb die 3.
und 4. Phase in seinem Buch "Logik der Forschung".
Eine Zusatzhypothese ist dann sinnvoll, wenn sie mehr als nur ein Phänomen
erklärt. Sie muss auch falsifizierbar sein.
Die Falsifizierbarkeit ist die Abgrenzung zwischen den Naturwissenschaften und
anderen Bereichen der Wissenschaft.
Beispiel für eine Zusatzhypothese:
Nachdem Herschel (London) 1781 den Planeten Uranus entdeckte,
wurde seine Bahn auf Grund der Newton'schen Gravitationstherorie und unter Berücksichtigung
der Einflüsse von anderen Planeten berechnet.
Nachdem Uranus für einige Wochen nicht sichtbar war, wollte man ihn auf
Grund der berechneten Bahn wiederfinden, was aber nicht gelang. Die Newton'sche
Theorie war somit falsifiziert. Man wollte sie aber nicht ganz aufgeben und
schränkte zuerst einmal ihren Gültigkeitsbereich ein.
Le Verrier und Adams stellten (voneinander unabhängig) jedoch die Zusatzhypothese
auf, dass es einen weiteren Planeten gibt, Neptun, der die Bahn von Uranus stört.
Nachdem LeVerrier den Aufenthaltsort für den 22. 12. 1846 berechnete, wurde
Neptun vom Astronomen Galle entdeckt. (Auch Adams hatte den Aufenthaltsort berechnet,
aber er war zu wenig berühmt und so "schaute niemand nach".)
Beispiel für Modifikation
der Theorie:
Die große Halbachse der Merkurbahn ist nicht ortsfest sondern dreht sich
(Periheldrehung). Dieser Effekt kann aber nur zu 95% durch
den Einfluss der Venus erklärt werden.
Um dieses Problem zu lösen, postulierte LeVerrier einen Planeten zwischen
Sonne und Merkur: Vulkan. Dieser wurde auch rund ein dutzend Mal gefunden (z.B.
1859 von M. Lescarbault und 1876 von Porro & Wolf), jedoch konnte keine
dieser Entdeckungen verifiziert werden. LeVerrier stellte daraufhin die These
auf, dass sich kein Planet dort befindet aber ein unregelmäßiger
Staubring, der so dünn ist, dass man ihn nicht sieht. Diese Zusatzhypothese
ist aber nicht falsifizierbar und wurde deshalb verworfen.
Das Problem der Periheldrehung konnte somit nicht auf der 3. Stufe gelöst
werden, die Newton'sche Theorie war falsifiziert! Da dies aber nicht nur eine
Frage der Logik sondern auch des Konsenses ist, und das Problem zu gering war,
um die Newton'sche Theorie zu vergessen bevor man etwas besseres hat, wurde
sie erst 1915 durch die Allgemeine Relativitätstheorie abgelöst.
Die Allgemeine Relativitätstheorie machte drei Voraussagen
(= Ergebnis einer Theorie das vom Experiment bestätigt oder widerlegt werden
kann, egal ob das Experiment schon durchgeführt wurde oder nicht):
die Rotverschiebung des Lichtes, die Periheldrehung von Merkur und die Ablenkung
des Lichtes an der Sonne.
Letztere wurde 1919 bei einer totalen Sonnenfinsternis überprüft und war auch Anlass für Karl Popper seine Wissenschaftstheorie zu entwickeln. Einstein sagte nämlich damals, dass seine ganze (schöne!) Theorie ungültig sei, falls die tatsächliche Ablenkung des Lichtes nicht mit ihr übereinstimmt.
Ein zweiter großer Wissenschaftstheoretiker war Thomas
Kuhn ("Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen").
Popper war der Meinung, eine neue Theorie muss die alte als Grenzfall enthalten,
Kuhn jedoch sagte, es gibt Zeiten der normalen Wissenschaft mit einem Paradigma
(= Theorie, die nicht in Frage gestellt wird). Widersprüche zu diesem Paradigma
werden solange negiert, bis es zu einer wissenschaftlichen Revolution kommt,
einem Paradigmenwechsel. Danach kommt wieder eine
Phase normaler Wissenschaft.
Ein weiterer Wissenschaftstheoretiker war Paul Feyerabend ("Wider den Methodenzwang").
Beispiel für einen Paradigmenwechsel:
Spezielle Relativitätstheorie
x' = x + vt -> x' = γ (x + vt); t'
= γ (t + vx/c²)
für v/c << 1 -> γ=1 ->
x' = x + vt; t' = t
Also ist einerseits die alte Theorie in der neuen enthalten (Popper), jedoch
ist die neue Theorie auch etwas vollständig neues, denn voher hätte
man t'=t nicht verstanden (Kuhn).
Oder in der Allgemeinen Relativitätstheorie: keine Schwerkraft, sondern
Krümmung der Raumzeit -> Paradigmenwechsel.
Da wir es in der Physik immer mit Messgrößen zu tun haben, gelten
alles Formeln mit der Genauigkeit, in der die Messgrößen bestimmt
werden können. Es ist also keine Limesbildung notwendig sondern für
v/c << 1 ist x'=x+vt exakt.
Ein weiteres Beispiel ist: e^x = 1+x = 1/(1-x).
Ein einziges Mal in der Geschichte der Wissenschaft ist es vorgekommen, dass ein Widerspruch auch auf der 4. Phase nicht eliminiert werden konnte: in der Quantenmechanik.
5. Phase: Synthese
Die Aporie von diskret und kontinuierlich wurde in die Theorie eingebaut (Welle-Teilchen-Dualismus).
In der Mathematik, der Ausfaltung der Logik gibt es jedoch laut 2. Axiom keine
Aporien.
Synthese (laut Hegel):
in der Synthese ist der Widerspruch aufgehoben, es müssen jedoch alle drei
Bedeutungen von "aufgehoben" erfüllt sein und dadurch etwas völlig
neues entstehen:
1. verwahren
2. eliminieren
3. hochheben
Der Menon-Dialog
Sokrates hinterließ keine Schriften, sein
Werk wurde von seinem Schüler Platon in der Form von Dialogen verfasst.
Menon war der Lehrer der Tugend, Sokrates wollte von ihm lernen, was Tugend
ist. Er widersprach ihm nie, zog nur aus allem die Konsequenzen, was zur Folge
hatte, dass Menon nicht mehr weiß, was Tugend ist, Sokrates aber erst
recht nicht.
Die These "der Schüler lernt vom Lehrer" war damit widerlegt,
denn Sokrates war ein guter Schüler, er wollte immer noch mehr wissen.
Nach den Gesetzen der Logik konnte nun nur die Antithese richtig sein: "der
Schüler lernt nicht vom Lehrer", aber da das "Lernen" existiert,
musste es heißen "der Schüler lernt aus sich selbst".
Sokrates wollte das nun beweisen, und ließ einen Sklaven, der zwar klug
war, aber noch nie Unterricht genossen hatte, kommen und fragte ihn nur. Mit
dem Ergebniss, dass der Schüler nachher wusste, dass der Diagonale eines
Vierecks keine Zahl entspricht (bzw. eine irrationale Zahl). Jedoch würde
er ohne die Fragen auch nichts wissen.
Es sind also beide Sätze richtig, es muss eine Synthese entstehen: "der
Schüler weiß schon alles, aber er weiß nicht, dass er es weiß".
Allein kann er nichts lernen, jemand muss ihn zum Selbstlernen bringen.
Sokrates führte auch den Begriff "Maieutik" (Eigentlich
Kunst der Hebamme, wie seine Mutter es war) für die Kunst des Lehrens und
Lernens ein.
Eine Synthese ist aber grundsätzlich nicht stabil, der Menon-Dialog wurde
vergessen, erst Carl Rogers griff ihn mit dem Begriff des "Lernhelfers"
auf.
Ein Beispiel für einen aufgehobenen Widerspruch ist "Freiheit & Ordnung", eine klare Aporie. Die Synthese besteht in der Autonomie (Selbstgesetzgebung) bei der alle Macht vom Volke ausgeht. In jedem Gesetz ist auch enthalten, wie man es wieder aufheben kann.
Einen Zustand, der stärker ist als die Elimination,
aber schwächer als die Synthese, ist die Operationale
Bewältigung. So wurde zum Beispiel der Grundwiderspruch
zwischen kontinuierlich und diskret in der Mathematik
durch die Definition eines Konvergenzkriteriums bewältigt. Dieser Widerspruch
wurde schon von Zenon formuliert, indem er sagte, dass ein fliegender Pfeil
ruht, denn er ist zu jedem Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Halbiert man die
Strecke zwischen dem Pfeil und seinem Ziel, so ist diese widerum ein Kontinuum
und kann beliebig oft halbiert werden. Der Pfeil kann sein Ziel also nicht erreichen.
Euklid meinte dazu: "man kann sich ein Kontinuum nicht aufgeschreiben vorstellen."
Die Mathematik hat, um dieses Problem zu lösen, das ε-Kriterium eingeführt
(für alle ε>0 existiert N(ε) mit n>N(ε)). So geht
die Folge 1/2, 3/4, 7/8,... gegen 1, erreicht 1 aber nie. Bei dem ε-Kriterium
sagt man, die Folge, ein Discretum, geht sehr nahe an 1, der Rest ist ein Kontinuum.
Man hat ein Verfahren (einen Algorithmus) zur Bestimmung des Grenzwertes, Discretum
und Kontinuum bleiben nebeneinander bestehend.
In der Quantenmechanik ist der
Widerspruch in allen drei Bedeutungen aufgehoben:
*) eliminiert durch die mathematische Beschreibung, die in sich widerspruchsfrei
ist
*) bewahrt, denn die mathematische Beschreibung bedarf einer Interpretation,
so ist |ψ|² = ρ entweder die Aufenthaltwahrscheinlichkeit oder
die Ladungsverteilung eines Elektrons im Kern
*) durch diese ersten beiden Tatsachen widerum ist er hochgehoben.
Eine Synthese ist aber nicht für alle Menschen einheitlich, so auch in der Quantenmechanik. Dies sieht man unter anderem dadurch, dass immer neue Bücher zu dem Thema geschrieben werden.
Durch die Synthese gewinnen wir ein Naturgesetz (die Natur ist ja etwas Gegebenes und nichts von uns Gemachtes; die Naturgesetze können wir nur durch den Ausschluss falscher Aussagen gewinnen).
Aus einem Naturgestetz kann aber logisch nichts gefolgert werden, es ist auch nicht logisch verständlich warum diese Methode funktioniert. Naturgesetzte sind nicht beweisbar (man kann nicht beweisen, dass etwas an jedem Ort des Universums und zu jeder Zeit gilt), sie sind aber auch nicht vernünftig bezweifelbar.
Der Weg, um ein Prinzip, oder Naturgesetz zu finden, ist die Intuition und die Einfühlung in die Erfahrung.
Wenn man das Spannungsverhältnis zwischen "richtig" (formal beweisbar) und "wahr" (vernünftig bezweifelbar) betrachtet, so stehen die Naturgesetze außerhalb, sie sind insoferne sicher, als sie verlässlich sind. Außerdem sind sie falsifizierbar und unabhängig von den Emotionen der Betroffenen (erst seit dem 17. Jahrhundert denkbar).
Etwas das "sicher" ist,
lässt sich nicht beweisen, Aussagen über die Natur sind (wenn ein
Konsens herrscht) absolut sicher wegen des "Vernünftigen Verhaltens
der Menschheit". Jemand, der die Naturgesetzte bezweifelt, wird "ausgeschlossen".
Es gibt aber keine logische Möglichkeit, zu zeigen, dass die Naturgesetze
sicher sind, es ist eine empirische Tatsache.
So kann die inhaltliche Beschreibung eines Naturgesetzes zwar falsch sein, es
ist aber trotzdem sicher.
Hat Newton die Schwerkraft, eine Kraft, die proportional zur Masse ist, entdeckt? Nein, denn sie ist nur ein Näherung, exakt gilt die allgemeine Relativitätstheorie, die keine Schwerkraft beinhaltet. Ist diese nun eine Entdeckung? Heutzutage und solange es keine bessere Theorie gibt schon.
Kant: Beobachtungen können keine Kausalität liefern, diese passiert erst durch den Geist. Wir können zum Beispiel nur erkennen "der Ball fällt nach unten nachdem ich ihn los gelassen habe" aber nicht "er fällt, weil ich ihn los gelassen habe". Somit ist die Realität für uns nicht erkennbar.
Zur Frage der Erkenntnis der Realität gibt es zwei wichtige Schulen:
Kritischer Realismus (nach Karl
Popper): es gibt eine Realität, die Naturbeschreibung ist ein Abbild davon.
Diese Abbildung wird immer besser. Die Methode der Naturwissenschaft ist die
Falsifikation, wir können zwar keine Theorie rechtfertigen, aber wir können
die Bevorzugung von Theorien rechtfertigen und erlangen so eine größere
Wahrheitsnähe.
Ein Kritikpunkt ist jedoch, da wir die Realität nicht erkennen können,
können wir auch nicht sagen, welche Abbildung besser ist.
Extremer Konstruktivismus: nachdem
die Realität nicht erkennbar ist, hat es keinen Sinn von ihr zu reden,
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse sind Konstruktionen des menschlichen
Geistes, eine Art kollektiver Solepsismus (nach Descartes; die einzige Wahrheit
ist die Existenz meines Körpers und Geistes, alles andere ist eine Konstruktion).
Es geht also darum, wessen Meinung (Konstruktion) sich durchsetzt.
Der Konstruktivismus ist logisch nicht zu widerlegen, jedoch ist ein Kritikpunkt,
dass laut eigener Aussage der Konstruktivismus Blödsinn ist, solange genügend
Leute ihn ablehen (er sich also nicht durchsetzt).
Eine Synthese (nach Prof. Pietschmann) der beiden extremen Anschauungen, ist
der Dialektische Realismus, der
zwischen Realität und Wirklichkeit unterscheidet (dies ist auch früher
schon geschehen, zum Beispiel durch Wolfgang Pauli).
Zur Realität, dem Vorhandenen haben wir keinen
Zugang, wir können über sie keine Aussagen machen. Deshalb konstruieren
wir eine Wirklichkeit, unser Bild von der Realität.
Eine weitere Unterscheidung ist folgende:
Die Lebenswelt, die Welt in der wir handeln, teilen
wir uns zum Beispiel mit den Tieren, jedoch reflektieren und beurteilen wir
im Unterschied zu ihnen unsere Handlungen und erzeugen dadurch eine Wirklichkeit,
die uns daran hindert, in der Lebenswelt zu leben. Sie ist nicht gedanklich
fassbar.
Die Realität ist im Unterschied zur Lebenswelt das, was die Wirklichkeit
sein sollte, wenn man die Realität erreichen könnte.
Zwischen Realität und Wirklichkeit existiert eine Spannung, sowohl äußerlich (ich-du) als auch innerlich (in sich selbst). Man ist für sich selbst eine unerkennbare Realität.
Nietzsche: "Werde
was du bist."
Augustinus: Sünde ist nicht mit sich selbst
identisch zu sein, wer liebt (liebe dich selbst wie deinen Nächsten) kann
nicht sündigen. Das eigene Gewissen (Realität) entscheidet, ob etwas
Sünde ist. Es entscheidet auch zwischen "gut" und "böse".
Bei einem Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Realität führen die Handlungen nicht zu den erwünschten Ergebnissen.
Die Naturwissenschaft verbindet das Denken (die
Wirklichkeit) und das Handeln (findet in der Lebenswelt
statt, wo keine Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit existiert).
Das Experiment überprüft nun, ob das Ergebnis, das bei einer Handlung
(bzw. Handlungskette) eintritt, mit dem übereinstimmt, was unsere Wirklichkeit
vorhersagt.
Ein Mythos ist ein Teil der Wirklichkeit, aus der wir aber keine Handlungsketten herleiten können.
Die Möglichkeit des "Check-List-Verhaltens" hat von den Naturwissenschaften auf andere Bereiche übergegriffen, zum Beispiel auf die Medizin oder die Bildung.
Denkrahmen (der Neuzeit):
| Reproduzierbarkeit Quantität Analyse Eindeutigkeit Widerspruchsfreiheit Kausalität |
Alles, was innerhalb ist, lässt sich mit der naturwissenschaftlichen Methode
und dem Check-List-Verhalten erfassen, etwas das außerhalb ist, nicht.
Zum Beispiel ist das Individuum oder der Wille der Menschen nicht drinnen.
Das Reduktionismus-Problem ist nun, dass man versucht,
Dinge von Außerhalb mit dem Denkrahmen zu erfassen.
Man schreibt also der Wirklichkeit vor, wie sie zu sein hat. Man spricht nicht nur vom naturwissenschaftlichen Reduktionismus, sondern z.B. auch vom biologischen.
Das Handeln sollte reproduzierbar, quantitativ und analytisch sein, das Denken
sollte eindeutig, widerspruchsfrei und kausal sein.
Alles was außerhalb ist, darf laut Reduktionismus nicht in den öffentlichen
Denkrahmen aufgenommen werden.
Dies liefert einerseits Erfolge, klammert aber auch vieles aus, die Gegensätze der oben genannten Eigenschaften sind:
| reproduzierbar quantitativ analytisch eindeutig widerspruchsfrei kausal |
einmalig qualitativ ganzheitlich bunt lebendig kreativ/final |
Hegel: die Kraft des Lebendigen ist es, den Widerspruch in sich zu halten.